
Siedlungsbau
der 30er Jahre
in Zehlendorf und Kleinmachnow
1
Mittelbusch und Hinterbuschgelände
1.1
Mittelbusch (Bebauungsgebiet "Zehlendorf-193")
Das Mittelbusch-Gelände war der letzte Rest eines Waldstücks der Zehlendorfer Heide, die zwischen Grunewald und Parforceheide lag und im Jahre 1896 gerodet wurde, um mehrere Villenkolonien entlang der Wannseebahn zu errichten. In diesem Waldstück wurden sogar um 1905 Spazierwege angelegt, sodass insgesamt eine parkähnliche Landschaft entstand.
Wegen
der raschen Ausdehnung dieser Villenkolonien entschloß sich die
Berliner Bauland GmbH Anfang der Dreißiger Jahre, auch den letzten
Waldbestand weiter zu verkleinern. Um aber die Bäume teilweise
zu retten, wurde eine Waldsiedlung geplant.

Rege Bautätigkeit 1937 im Westhofener
Weg (Sammlung Großkopf)

Westhofener Weg 20 im Bauzustand, 1936 (Sammlung
Großkopf)

Westhofener Weg 20 und 22 gerade fertiggestellt, 1937 (Sammlung
Großkopf)
In
den Jahren 1934-1938 herrschte ein regelrechter Bauboom im Mittelbusch.
Abweichend von den anderen Siedlungen, die in der Zeit des Nationalsozialismus
in Zehlendorf entstanden, baute man zwei unterschiedliche Häusertypen:
Typ 1 war die sog. "Kaffeemühle", ein zweigeschossiger Bau mit
einem 30 Grad geneigten Walmdach; Typ 2 war die normale "Reichsheimstätte",
ein eingeschossiges Haus mit 50 Grad geneigtem Satteldach (vgl. die
Abbildung unten ). Typ 2 ist in allen Siedlungen vorherrschend.
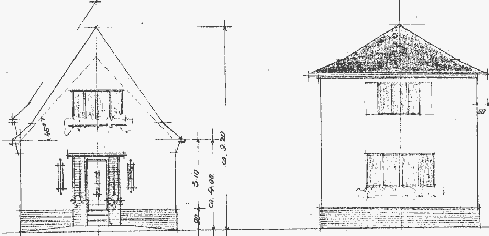 Bauvorschriften
1930-1939 der Baupolizei (Sammlung Großkopf)
Bauvorschriften
1930-1939 der Baupolizei (Sammlung Großkopf)
Insgesamt wurden im Mittelbusch 233 Grundstücke bebaut, fast alle von verschiedenen Architekten. Bei der Innenausstattung einiger Villen wirkten Künstler des Bauhauses mit. Das ist noch heute an Details wie Türklinken, Zimmerdecken etc. zu erkennen.
Die Bezirksverwaltung benannte die Straßen nach rheinhessischen Winzerorten oder nach Prominenten des Ortes (vgl. Haagstr. , Hugo v. Krottnaurer).
1.2
Nikolassee-Ost Die
Villenkolonie Nikolassee-Ost erstreckt sich auf einer kleinen Fläche
zwischen Mittelbusch und Rehwiese, deren Parzellierung etwa im Jahre 1920
von der Heimstätten-AG veranlaßt wurde. Die Gesellschaft hatte
bereits um die Jahrhundertwende die Siedlungen in Schlachtensee und Nikolassee-West
errichtet. Erste Bauten standen schon in den 20er Jahren, weitere kamen
in den "Siedlerjahren" 1935-1940 hinzu. Im Großen und Ganzen wurde
die Kolonie aber erst in den 60er Jahren vollendet, sodass sie keine reine
Reichsheimstättenkolonie darstellt. Der Berliner Bodenverein führte
damals die Reklameaktionen für die Villenkolonien in Nikolassee (-Ost)
durch (vgl. Abbildung unten).

Flugzettel 1934 (Sammlung Großkopf)
Beispiel:
Der Westhofener Weg in der Villenkolonie Nikolassee-Ost
Der Bau der Straße "Westhofener Weg" 1905-39
1905
war das Gebiet um Wethofener, Osthofener und Pfeddersheimer Weg das
letzte Stück der Zehlendorter Heide, die sich vom Grunewald bis
zur Parforceheide erstreckte. Dieses Gebiet, auch genannt der „Mittelbusch“
wurde 1905 an die Berliner Bauland verkauft, damit es Bauland wurde
und dem schon 1900 fertiggestellten Nikolassee als Villenkolonie angegliedert
werden konnte. 1906 legte dann die Berliner Bauland die Strape „358“
an, an der ab 1935 die ersten Häuser standen. Am 1.August des gleichen
Jahres wurde dem Weg der Name des rheinhessischen Weindorfes Westhofen
gegeben.

Kleine Chronik des Westhofener
Weges
Statistik: Durch den WW verläuft die alte von-Luckstraße,
und zwar durch die Grundstücke 15,17,14,16 und 18.
Die kürzeste
Straßenfront mit 10,52 m hat das Haus Nr. 13.
Die längste Straßenfront mit 57,74 m hat das Haus Nr. 12.
Das Haus
Nr. 16 liegt auf den meisten Parzellen und zwar 1872,1873,1874 und 1875
in den Flurgebieten 25,26,27 und 36.
1905/6: Anlegung der Straße 358 von der Berliner
Bauland GmbH
1.8.1935: Umbenennung der Straße 358 in Westhofener
Weg (Westhofen ist ein Dorf in Rheinhessen)
19.12.1935: Verschiedene Hausanschlüsse werden
verlegt
5.7.1937: Nach einem Gewitter werden einige Grundstücke
wegen fehlender Regenentwässerung der Straße überschwemmt.
6.10.1939: Bau der Regenentwässerung
1939-1945: Als 1939 die letzten Häuser im Westhofener
Weg bezogen waren fing der Krieg an. Die meisten Bewohner wurden zum
Bau eines Luftschutzkellers aufgerufen. Man merkte sehr wenig vom Kriegsgeschehen
im WW. In Nr.17 schlug eine Brandbombe ein und das nahegelegenen OT-Lager
wurde ein paar mal angegriffen, wobei allerdings viele italienische
Soldaten getötet wurden.
Die Kinder
der einzelnen Familien spielten - wie vor dem Krieg- miteinander, die
Bewohner wurden anfangs noch von Bolle oder dem nahegelegenen Bauer
Hönow versorgt. In den letzten Kriegsjahren verpflegten sich viele
Familien selber, indem sie ihre Gärten in Gemüseäcker
umwandelten.
1945 kamen dann viele russische Panzer aus Süden
und wollten den WW durchfahren, wobei einer in der Garageneinfahrt von
WW20 stecken blieb und erst Jahre später geborgen wurde.
1953:
Im Abschnitt A des W.W. wird die Regenentwässerung vollendet.Fahrbahn
im Abschnitt A bituminös, Abschnitt B Kopfsteinplaster.
Nach dem zweiten Weltkrieg kam Nikolassee zum amerikanischen Sektor.
Viele Familien wurden aus ihren Häusern verbannt, um amerikanischen
Offizieren Platz zu machen. Die Besitzer, deren Häuser nicht beschädigt
waren, mussten Baunotabgabe an die obdachlos gewordenen Berliner zahlem-
Ab 1948 ging man wieder zu Bolle an der Potsdamer Chaussee einkaufen
oder trug seine Wäsche zum Mangeln in die Beskidenstraße.
Die Kinder besuchten oft das Puppentheater im Kirchweg oder jagten Smaragdeidechsen.
Nach dem wiederaufbau blieb es still in Nikolassee.
1955 wurde der Hönowhof abgerissen. Willy Brandt
gibt den Spatenstich für ein neues Studentendorf der Freien Universität.
Es wird auf den früheren Kornfeldern gebaut.
1961 wurde in einem Kilometer Entfernung die Mauer
gebaut. Der ehem. Nachbarort Kleinmachnow wird abgetrennt. Die Grundstückspreise
fallen auf 1 DM pro Quadratmeter.
1960: Umbauarbeiten der Einmündung W.W. in den
Pfeddersheimer Weg
20.11.1962: Herstellung eines Fußweges
1963: Pflasterung des Bürgersteiges und Vollendung
der Regenentwässerung im Abschnitt B.
1966: Erneute Umbauarbeiten an der Einmündung
in den Pfeddersheimer Weg
4.3.1970: Gehwegarbeiten
1971 Nikolassee erhält eine Kirche, die gegenüber
der Westschule gebaut wird.
4.9.1972: Restausbau der Fahrbahnen und Gehwege
90er Jahre: Die Häuser Westhofener Weg 1, 21 und
27 wurden abgerissen und durch Neubauten ersetzt.


oben: Westhofener Weg 1 (Abriss 1995)
mitte: Westhofener Weg 21 (Abriss 1988)
unten: Westhofener Weg 27 (Abriss 1997)
1.3 Hinterbusch (Waldhaus)
Der alte Name "Hinterbusch" ist heute niemandem mehr geläufig, da sich nach dem Krieg in den Köpfen der Berliner der Name Waldhaus einbürgerte (vom nahegelegenen Sanatorium Waldhaus abgeleitet). Ende der 20er Jahre wurde das Waldstück zwischen Potsdamer Chaussee und Stammbahn parzelliert. In den folgenden Jahren entstanden nur wenige Häuser im Gebiet hinter dem Sanatorium. Der Bau der Reichsautobahn "Nummer 51" (heute BAB 115), die direkt am Hinterbusch vorbeiführte, schreckte viele Bauwillige ab, hier ihr Domizil zu errichten.
Wegen
der Bauflächenknappheit im Nachkriegs-Berlin wurde aber auch diese
etwas ungünstig gelegene Fläche notgedrungen in den 60er Jahren
besiedelt. Das Gebiet ist deshalb keine 'echte' 30er Jahre-Siedlung.
Heute wird die Attraktivität der Siedlung vor allem durch den Lärm
der nahegelegenen Avus und durch die vielen stillosen Neubauten, die
bis Ende der 80er Jahre hinzukamen, gemindert.
2
Bürgerhaussiedlungen Kleinmachnow
2.1 Villenkolonie des "Adolf Sommerfeld"
Für
dieses Kernstück der Bürgerhaussiedlung des jüdischen
Architekten Sommerfeld gibt es eigentlich keine richtige Bezeichnung.
Viele Berliner sehen es oft als Zentrum Kleinmachnows.
Adolf Sommerfeld begann 1932 im Bauabschnitt am Düppelpfuhl mit
150 Häusern. Alle Häuser übergab er schlüsselfertig
den Bauherren. Es gab auch in dieser Siedlung den Normaltyp. Ein weiterer
Häusertyp, eine Art Reihenhaus, bestehend aus vier kleinen "Normalhäusern"
unter einem Dach, wurde hier erstmalig gebaut.
Als Straßennamen verwendete man Bezeichnungen aus Wald und Flur(Wendemarken,
Steinweg), sowie ortsspezifische Bezeichnungen (An der Stammbahn, Schleusenweg).
Im Jahre 1933 mussten Adolf Sommerfeld emigrieren, doch der Ausbau seiner
Siedlung wurde bis 1938 vollendet. Diese Siedlung wurde als vorbildliche
deutsche Kolonie von den Nationalsozialisten gefeiert.

Düppelpfuhl, Teich im Mittelpunkt der Bürgerhaussiedlung
2.2 Musikerviertel
Das Musikerviertel am Nordwestrand Kleinmachnows war zweiter Bauabschnitt der Bürgerhaussiedlung. Dieses Gebiet, deren Straßen die Namen berühmter Komponisten tragen, wurde 1934 vollendet. Die Villen im Viertel wurden mit "agrarromantischen und antistädtischen Ideologien" [Wolfgang Schäche in " Architektur u. Städtebau in Berlin 1933-1945"] gebaut.
2.3 Schrobsdorf und Hermann-Siedlung (Seeberg)
Als
Seeberg-Siedlung bezeichnete man das Gebiet zwischen Heidefeld und Märkischer
Heide, welches bis 1938 von der Schrobsdorfschen Gesellschaft gebaut
wurde.
Auch diese Siedlung wurde als deutsche Vorzeigesiedlung angepriesen:
Die Hauseigentümer sorgten für Ordnung im ganzen Viertel.
Es gab besondere Putzverordnungen und Vorgaben für die Bepflanzung,
so durften in den Straßen, nach Tieren und Orten aus Wald und
Flur benannt, nur ‘urdeutsche’ Bäume wie Eichen oder Linden gepflanzt
werden. Für Laub- und Schneeräumung mussten die Bürger,
sofern sie körperlich in der Lage waren, selbst aufkommen, die
Straßenreinigung übernahm die Gemeinde.
2.4 Winklersche Siedlung
Der
Architekt C.A. Winkler war der erste Bauunternehmer, der in den 30er
Jahren in Kleinmachnow plante. Er wollte das Gelände zwischen der
Eigenherdsiedlung (1922-25) und dem alten Dorf südlich des Teltowkanals
bebauen. Er bot Interessenten für 8000 Mark ein fertiges Haus mit
einem ca. 1000m² großem Grundstück an. Auch Winkler
benutzte das Konzept einer "Waldsiedlung im Föhrenforst Kleinmachnows".
Er kam 1927 aus Zehlendorf, nachdem er mehrere Siedlungen in Röntgental,
Fichtenau und Königstal (Nordostbezirk Berlins) gebaut hatte nach
Kleinmachnow.Insgesamt verkaufte er 350 Parzellen nördlich des
Machnower Sees und 70 Grundstücke am Weinberg (südlich des
Kanals).
2.5
Machnower Busch-Gelände

Die
Siedlungsgesellschaft der Konrad Géradsche Erben parzellierte
und offerierte in den Jahren 1935-1938 das Gelände zwischen Düppelpfuhl,
Wolfswerder, Duellpfuhl und Machnower Busch. Damit schloss das Bauunternehmen
das Gelände zwischen Eigenherd-Siedlung, Bürgerhaussiedlung
und Erbbausiedlung. 1936 bekam die benachbarte Eigenherd-Kolonie eine
Schule am Meiereipfuhl, zu der auch Kinder vom Machnower Busch geschickt
wurden. Die Straßen benannte man - wie in vielen anderen Siedlungen
- nach Wald-, Flur- und Tiernamen.
3.1
Nordteil Düppel (X-194)

Singener Weg
Das
besondere an der Eigenheimsiedlung ist, dass alle Hauseigentümer
ihre Grundstücke nicht kauften sondern mit einem Erbbauzins verpachten
konnten, d. h. sie zahlten sozusagen 200 Mark Miete im Monat für
Grundstück und Haus, sodass sie in der Lage sein sollten, die Häuser
am Ende des Jahrhunderts (also im Jahre 1999) für wenig Geld zu
erwerben. Diese Erbbauzinsverträge mit der Stadt Berlin liefen
vorheriges Jahr aus. Die Hälfte der Hauspächter konnten ihre
Häuser kaufen, die anderen mussten sie entweder räumen , oder
mieteten ihr Grundstück für ein höheres Entgelt beim
Eigentümer Berlin.
Im Jahre 1935 bebaute der Architekt Ernst Giller 27 der
34 Grundstücke des nördlichen Siedlungsteils, der auf dem
Gelände des ehemaligen Rittergut Düppel lag.
Alle Häuser waren nach dem selben Muster im "Heimatschutzstil"
mit "bodenständigen Bauweisen und Bautradtionen" für das "städtische
Kleinbürgertum" errichtet
Neben der Grundaustattung (Fassade, Satteldach mit 50 Grad Neigung)
konnte sich der Pächter Fensterläden, Garage, Veranda und
Balkone selbst aussuchen.
Für die Namensgebung der Straßen wurden auch
hier Winzerorte aus dem Südwesten Deutschlands verwendet.
(Zitate aus W. Schäche,
Architektur und Städtebau in Berlin 1933-1945).
3.2 Südteil Zehlendorf (X-192)
Den
Südteil der Erbbausiedlung baute man nach dem gleichen Prinzip.
1936 wurde hier der erste Spatenstich getan. 43 von den 50 Häusern
plante wieder Ernst Giller. Zwischen Buschgraben und Stammbahn wurde
in einem dreiecksförmigen Carée gebaut. Die Wege wurden
nach württembergischen Orten benannt.

Uhldinger Weg
3.3 Planungen für Düppel-Süd
Das
Gebiet Düppel-Süd bezeichnet die Fläche zwischen Stammbahn,
Buschgraben und Kleinmachnow. Anfang der dreißiger Jahre plante
auch hier die Berliner Bauland ein zweites "Mittelbusch-Gelände",
also eine Bebauung mit Normalvillen und Kaffeemühlen. Wegen unterschiedlicher
Interessen der Bauherren und Konflikte mit der Stadt blieben die bereits
fertiggestellten Straßen "Bechtheimer Weg" und "Dittelsheimer
Weg" brach liegen. Erst 1955 begann man, das Gelände umzustrukturieren
und baute kleine Reihenhäuschen. Die vorhandenen Wege riss man
ab.
Einkaufsmöglichkeiten,
Zentren und Schulen.
Ein
richtiges Zentrum im Reichsheimstätten-Südwestbezirk gab es
nicht. Die unterschiedlichen Siedlungsgesellschaften hatten individuelle
Interessen und eigene Ladenzeilen. Der Mittelbusch ging bei Bolle an
der Potsdamer Chaussee einkaufen (heute Tauch-Laden, Waldfriedhof),
das 100 Meter entfernte Nikolassee-Ost hingegen erledigte seine Besorgungen
in einer Ladenbaracke an der Rehwiese (abgerissen, heute Edeka). Die
Erbbausiedlung hatte für den täglichen Bedarf einen kleinen
Laden am Bahnübergang Idsteiner Weg (heute Getränke Hoffmann).
Die Einwohner der Bürgerhaussiedlung und der Siedlung am Machnower
Busch wanderten zum Düppelpfuhl zum Einkaufen, wo heute die Hauptladenstraße
Kleinmachnows ist. Die Winklerschen Hauseigentümer gingen zur Förster-Funke-Allee
(welche Hauptstraße des Ortes vor dem Krieg werden sollte und
nach neusten Planungen auch wieder werden soll). Die Familie vom Seeberg
kaufte an der Hohen Kiefer ihre Lebensmittel.
Die Kinder der nördlichen Siedlungen drückten entweder auf
der Westschule (heute Tewsgrundschule, 1927 err.) oder im nationalsozialischten
Bau der Dreilinden-Schule (1937, für die Kinder Goebbels, der in
Nikolassee wohnte, errichtet) die Schulbank.
Aus der Erbbausiedlung gingen die Pennäler auf das Gymnasium in
Zehlendorf. Erst in den 70ern erhielt man eine Grundschule.
Die Kleinmachnower Sprösslinge hatten genausolange Schulweg zur
Eigenherdschule, 1936 gebaut ; zur Weinbergschule, 1940 geb. oder zur
Schleusenwegschule, 1945 in Baracken errichtet. Erst 1969 erhielt die
Bürgerhaussiedlung und das Musikerviertel eine eigene Lernanstalt,
nämlich die Steinwegschule.
Öffentlicher Personennahverkehr
Direkt
im Mittelpunkt aller Siedlungen hielt die Stammbahn, sie ist die erste
preußische Eisenbahn, welche 1838 von Berlin nach Potsdam eröffnet
wurde. Die Ortschaften entlang der Trasse entwickelten sich rasant.
Mit dem Bau der Wannseebahn 1874 und der Friedhofsbahn 1913 war die
Gegend zwischen Grunewald und Teltowkanal bestens erschlossen. Außerdem
verkehrten mehrere Omnibuslinien in den Ortskern Zehlendorf oder zum
nächsten Fernbahnhof in Wannsee.
Von der Grenzziehung 1949 bis zum Mauerbau 1961 verschlechterte sich
der öffentlichen Nahverkehr schrittweise. Die Kleinmachnower konnten
nur mit Ausweiskontrolle zu ihrem Bahnhof im Grenzgebiet kommen, ein
paar Jahre später war dann auch damit Schluss. Alle grenzüberschreitenden
Bahnlinien wurden stillgelegt, und bis heute nicht wieder in Betrieb
genommen worden. 1972 bekam die Erbbausiedlung einen eigenen Bahnhof,
der einzige Bahnhofsneubau in Westberlin. Acht Jahre später wurde
aber die gesamte Strecke ( nach dem Eisenbahnerstreik der ostdeutschen
Reichsbahn ) stillgelegt. So war der neue Bahnhof kein Vorteil für
die "Eigenheimler".
Seit der Wende verkehren aber wieder Busshuttles für die Kleinmachnower
zum U-Bahnhof Krumme Lanke, somit gibt es wieder eine Anbindung an Berlin.
Zur Zeit wird diskutiert, ob die Stammbahn wiedereröffnet wird.
Dann hätten frühestens 2003 die Villenkolonien wieder einen
gemeinsamen, zentralen Bahnhof.
Reichsautobahn 51 (Avus)
Im
Jahre 1913 baute eine königliche Automobilstraßen-GmbH eine
Piste für Autorennen, welche in Charlottenburg begann, parallel
der Eisenbahn durch den Grunewald verlief und in Nikolassee endete.1921
wurde die Strecke der "Avus" , der Automobil-Verkehrs-und-Übungs-Straße,
für den Verkehr freigegeben.
Im Jahre 1938 begann man mit der Verlängerung der Avus zum Berliner
Ring. Ab sofort wurde die Rennstrecke zur Reichsautobahn Nummer 51.
Die Trasse wurde durch den älteren Ortsteil Nikolassees geführt.
An der Dreilindenschule kreuzte die Autobahn die Potsdamer Chaussee.
Dieses Kreuz war die Auffahrt für alle Bewohner der Reichsheimstättensiedlungen
gedacht, die nach Berlin hinein oder aus Berlin heraus mit dem Auto
fahren wollte. 1939 entschied man sich für eine Linienführung
zugunsten Kleinmachnows, und zu ungusten des Hinterbusches, der bis
dato noch ziemlich ruhig lag, doch dann unter der ansteigenden Zahl
des Autoverkehrs nach dem Krieg und den vielen Staus am späteren
Grenzkontrollpunkt Dreilinden zu leiden hatte.
Doch wegen des Grenzverlaufs entlang der Autobahn entschloss sich die
DDR 1969, die Autobahntrasse an Kleinmachnow vorbei nach Potsdam zu
verlegen. Dies führte langezeit zur massiven Lärmbelästigung
im Musikerviertel und in der Schrobsdorf und Hermann-Siedlung. Dies
hat sich auf brandenburgischer Seite jetzt fast gelegt, da man Lärmschutzwände
errichtet hat. So hat man zumindest in Kleinmachnow das Villengebiet
vor der Verminderung der Lebensqualität bewahrt.

stillgelegte Reichsautobahn 51, 1996